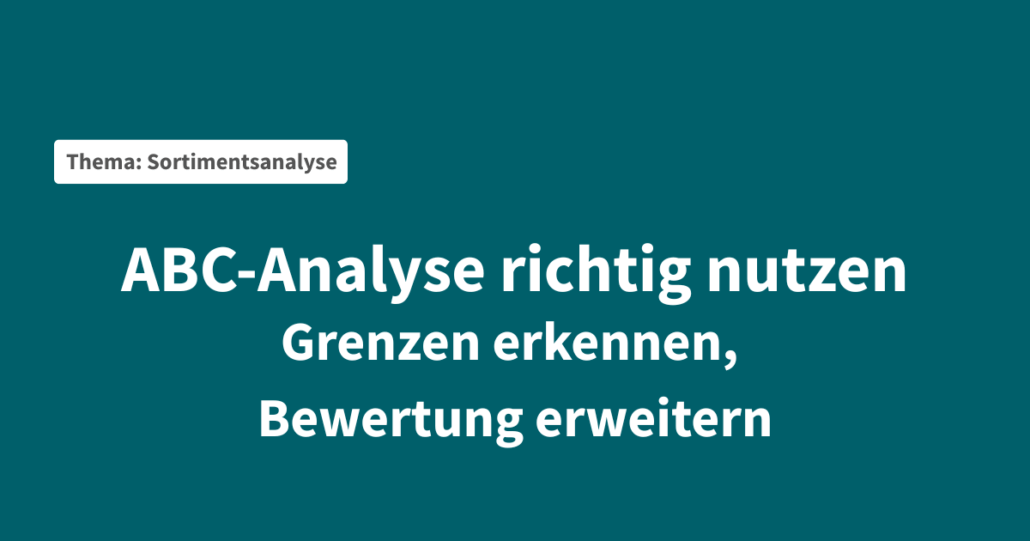Die ABC-Analyse hat ihren festen Platz in der betrieblichen Praxis. Viele Warenwirtschaftssysteme erstellen diese Auswertungen automatisch. Doch was auf den ersten Blick nach objektiver Bewertung aussieht, kann bei näherer Betrachtung irreführend sein. Der Fokus auf einen einzigen Kennwert reicht für fundierte Sortimentsentscheidungen nicht aus.
Die Grenzen der automatisierten ABC-Bewertung
Eine typische ABC-Auswertung zeigt meist die klassische Pareto-Verteilung: 20 Prozent der Artikel generieren 80 Prozent des Umsatzes. A-Produkte stehen für hohe wirtschaftliche Leistung, C-Produkte für geringe. Das Problem liegt in der einseitigen Betrachtung. Aspekte wie Kundenbindung, Sortimentsrolle oder Profilwirkung bleiben bei dieser isolierten Betrachtung außen vor.
Beispiel aus dem Handelsalltag: Ein Premium-Olivenöl in der Feinkost-Abteilung fällt in die C-Kategorie. Der Umsatz ist niedrig, die Marge aber hoch. Das Produkt stärkt die Glaubwürdigkeit der gesamten Abteilung und zieht qualitätsbewusste Kunden an. Eine reine ABC-Bewertung würde zur Auslistung führen. Strategisch wäre das ein Fehler.
A-Produkte sind nicht automatisch sicher
Hohe Umsätze bedeuten nicht zwangsläufig strategischen Wert. A-Produkte können durchaus problematisch sein: bei zu hoher Abhängigkeit von wenigen Artikeln, bei saisonalen Schwankungen oder wenn sie nur durch massive Rabattierung laufen. Auch Profilbrüche sind möglich, wenn diese Produkte nicht zur Zielgruppe oder Positionierung passen.
B- und C-Produkte bieten oft ungenutztes Potenzial
Produkte der B-Kategorie erhalten im Tagesgeschäft häufig weniger Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich oft um stabile Sortimentsbestandteile mit Entwicklungsmöglichkeiten. Gezielte Investitionen in Sichtbarkeit, Kommunikation oder Platzierung können hier große Effekte erzielen.
Entscheidend ist die Funktion einzelner Produkte im Sortimentskontext. C-Produkte können als Ergänzungssortiment, für die Kundenbindung oder zur Profilabrundung unverzichtbar sein. Eine differenzierte Bewertung berücksichtigt neben wirtschaftlichen Kennzahlen auch Kundenfeedback, Retourenverhalten, Beschaffungsrisiken und strategische Bedeutung.
Systematische Bewertung statt Zahlengläubigkeit
Eine fundierte Sortimentsanalyse kombiniert quantitative und qualitative Kriterien. Ein strukturiertes Scoring-Modell kann helfen: Wirtschaftlicher Beitrag, Sortimentsrolle, Kundenresonanz, Lieferbarkeit und Zukunftspotenzial werden gewichtet und bewertet. Daraus entsteht ein Gesamtwert als Orientierung für Sortimentsentscheidungen.
Die ABC-Analyse markiert den Ausgangspunkt für vertiefte Überlegungen, nicht deren Ergebnis. Sie schafft Orientierung zur wirtschaftlichen Bedeutung, ersetzt aber keine ganzheitliche Bewertung mit strategischem Weitblick.
Im Online-Kurs Sortimentsanalyse gehen wir auch auf die ABC-Analyse ausführlich ein und zeigen, mit welchen Daten und Informationen man sie zu einem zentralen Instrument ausbaut.